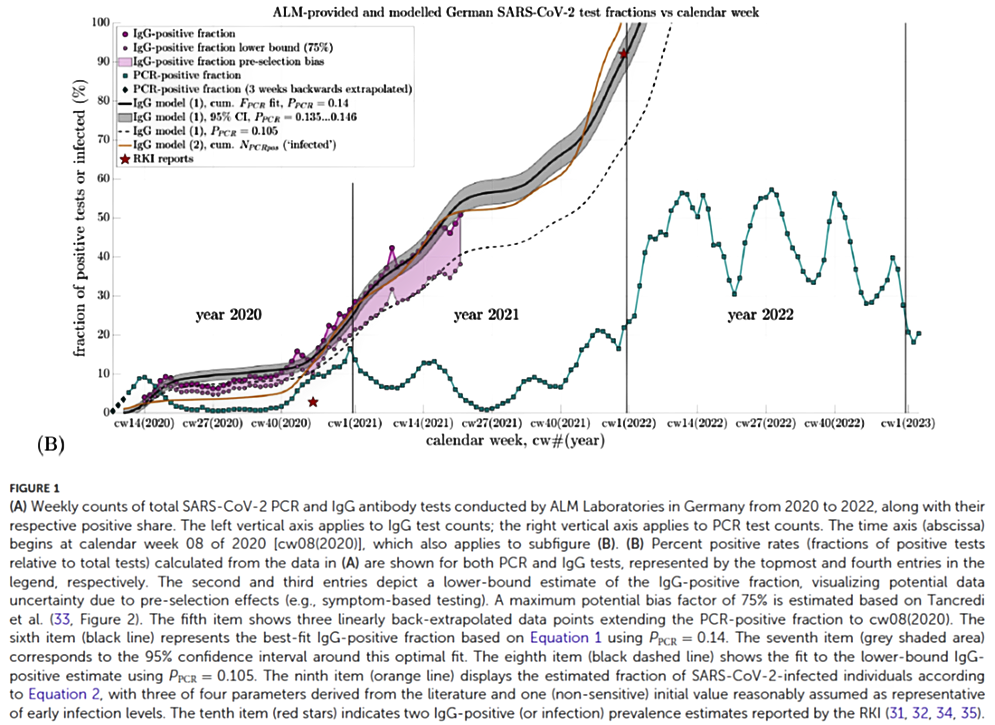Schuldeingeständnis der amerikanischen Gesundheitsbürokratie zum Fehlgriff bei den Corona-Maßnahmen und Neuausrichtung auf „Autoimmunität“
Der Personalwechsel innerhalb der US-amerikanischen Gesundheitsbehörden hat neue Schwerpunkte zur Folge. Jay Bhattacharya ist seit 2025 Direktor der National Institutes of Health, jener Superbehörde, die selbst Forschung betreibt und einen Großteil der Forschung in den USA durch große Programme fördert. Außerdem wurde Anthony Fauci als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) nach einer kurzen Interimsphase durch Jeffery Taubenberger ersetzt.
Die Corona-Maßnahmen waren falsch und haben der Reputation des NIH und der Wissenschaft geschadet
In einem Leitartikel in Nature Medicine, der die neue Richtung dieses Institutes beschreibt, distanzieren sich Bhattacharya, Taubenberger und ihr Co-Autor Powers nun sehr deutlich im Grunde von allem, was das Pandemiemanagement der USA und in der Folge fast der ganzen Welt ausmachte [1].
Wörtlich schreiben die Autoren:
„… viele der empfohlenen politischen Maßnahmen, einschließlich Lockdowns, sozialer Abstandsregeln, Tragen von Masken und Impfpflicht hatten keinerlei wissenschaftliche Basis und sind umstritten, was ihre positiven Wirkungen und ihre unbeabsichtigten Nebenwirkungen angeht… Uns steht vor Augen, dass ein großer Teil der amerikanischen Öffentlichkeit das Vertrauen in das NIAID, die National Institutes of Health (…) und darüber hinaus in die wissenschaftliche Gemeinschaft verloren hat. Als momentane Leiter der NIH und des NIAID anerkennen wir diesen Vertrauensbruch…“
Bleiben wir einen Moment bei diesen Worten. Sie beschreiben nichts weniger als die Anerkennung, dass die Kernelemente des sog. „pandemic response“, also der Antwort der Politik auf die Pandemie, bar wissenschaftlicher Fundierung waren.